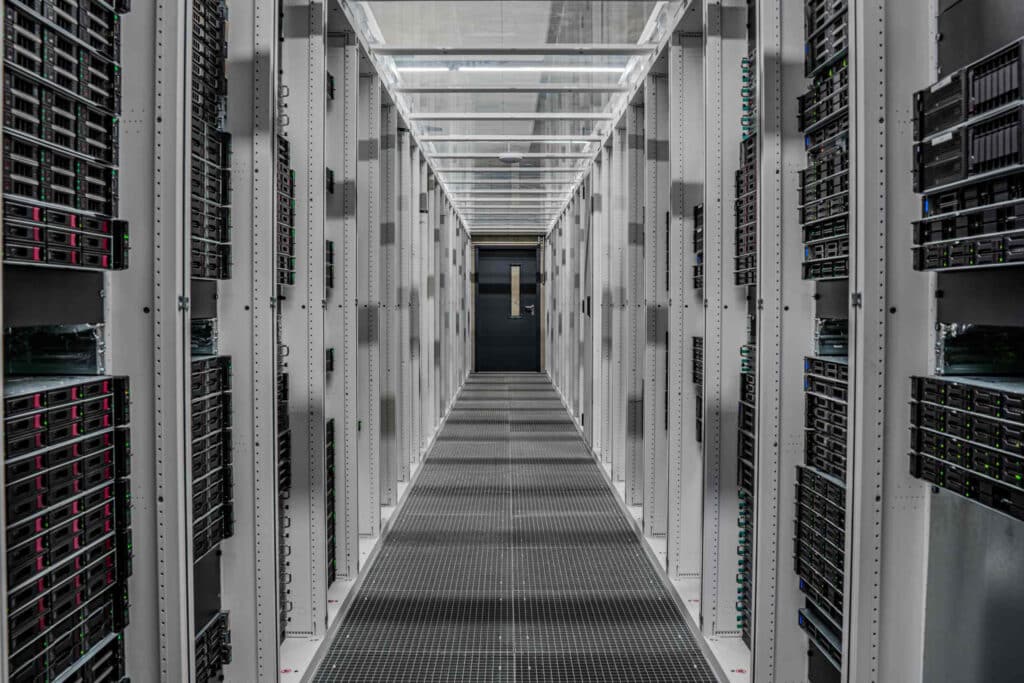Dieser Fachbeitrag von ist in der interdisziplinären Zeitschrift Strassenverkehr, Ausgabe 2/2023, erschienen. Wyssmann LLC unterstützt das Pilotprojekt der Designwerk Technologies AG bei der Dissemination.
Hintergrund des Projekts
Der Personen- und Güterverkehr steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Innerhalb der Europäischen Union entfällt rund ein Viertel der Emissionen des Strassenverkehrs auf Trucks. Sie entstehen durch die rund 6,6 Millionen Lastkraftwagen, die täglich im Einsatz sind. Diese transportieren 76,7 Prozent aller Frachten an Land. Sollen die Klimaziele bis 2030 erreicht werden, müssen auch die CO2-Emissionen des Schwerlastverkehrs europaweit reduziert werden.
Auch in der Schweiz fällt ein wesentlicher Anteil des CO2-Ausstosses auf den Strassenverkehr zurück. Der Anteil des Verkehrs am Schweizer CO2-Ausstoss beläuft sich auf rund 40 Prozent. Davon sind rund 15 Prozent auf den Schwerlast- und den Busverkehr zurückzuführen. Dabei liessen sich gemäss der Designwerk Technologies AG durch die Elektrifizierung eines einzelnen Lkw mit einer Jahreslaufleistung von rund 60‘000 Kilometer je nach Szenario jährlich zwischen 50 und 70 Tonnen CO2 einsparen.
Eine Elektrifizierungswelle, wie sie im Personenverkehr bereits im Gange ist, könnte folglich zu einer substanziellen Senkung unserer Schadstoffemissionen beitragen. Allerdings gestaltet sich die Elektrifizierung im Langstrecken- und Schwerlastverkehr anspruchsvoller.
Aktuelle Marktsituation und verfügbare Technologien
Während sich im Kurz- und Mittelstreckenverkehr viele Logistikszenarien durch E-Lkw abdecken lassen, sind im Schweizer Langstreckenverkehr kaum batterieelektrische Transportfahrzeuge im Einsatz. Auch im Dauer- oder Schichtbetrieb scheinen E-Lkw derzeit zu unattraktiv. Begründet wird das mit der begrenzten Batteriekapazität und der begrenzten Ladeleistung.
Dazu ein Gedankenspiel: Um einen konventionellen 40-Tonnen-Diesel-Lkw für einen Langstreckeneinsatz bis zu 1‘000 Kilometer ohne Zwischenladung durch einen E-Lkw zu ersetzen, müsste sich dessen Batteriekapazität auf bis zu 1’360 kWh belaufen. Die Batterien hätten in diesem Fall und unter Berücksichtigung heutiger Energiedichten ein Gesamtgewicht von rund 9 Tonnen. Ein kompletter Ladezyklus würde mit den schweizweit schnellsten Ladestationen rund 5,5 Stunden dauern. Der Einsatz elektrischer Lkw mit derartigen Batteriekapazitäten ist aufgrund der damit verbundenen Anschaffungskosten, Einbussen bei der Nutzlast und der geringeren Einsatzbereitschaft in der Regel nicht zweckmässig. Die Kapazität der derzeit in Europa erhältlichen E-Lkw beläuft sich üblicherweise auf weniger als die Hälfte dieses hypothetischen Szenarios.
Zu bedenken gilt es auch, dass geringer dimensionierte Batterien die CO2-Bilanz der Fahrzeuge entlasten. Für einen Wandel in den jeweiligen Segmenten ist deshalb besonders leistungsstarke Ladeinfrastruktur erforderlich. Eine solche würde es erlauben, die Batterien bereits während kurzer Pausen oder bei Zwischenstopps zu laden. Die dafür notwendige Infrastruktur unterscheidet sich allerdings von der für Pkw.
Die leistungsfähigsten heute am Schweizer Markt verfügbaren Ladesysteme sind mit manuellen Stecksystemen (CSS, Typ 2) ausgerüstet und für Ladeleistungen von bis zu 350 kW ausgelegt.

Mit einem leistungsfähigeren Ladesystem im Megawattbereich liessen sich Ladezeiten deutlich verkürzen. Der Einsatz einer solchen Lösung ist auch für Baumaschinen oder Schiffe denkbar. Die entsprechende Infrastruktur könnte so die Wettbewerbsfähigkeit batterieelektrischer Nutzfahrzeuge sowie Maschinen erhöhen. Zudem wären sie dann für neue Logistikszenarien im Dauer- und Schichtbetrieb einsetzbar. Die Kehrseite: Es ist zu berücksichtigen, dass Ladevorgänge mit einer derartigen Leistung zu erheblichen Lastspitzen führen können. Deshalb gilt es, negative Auswirkungen auf das Stromnetz zu verhindern.
Motivation zur Durchführung des Projekts
Eine Ladestation der Megawatt-Klasse wird derzeit bei der Designwerk Technologies AG in Winterthur entwickelt. Das partnerschaftliche Demonstrationsprojekt soll den Langstreckeneinsatz von Elektro-Lastkraftwagen ermöglichen und das Stromnetz entlasten. Technische Grundlage ist ein neuer Ladestandard für schwere Nutzfahrzeuge.
Die Designwerk Technologies AG mit Sitz in Winterthur treibt als Anbieterin von E-Mobilitätslösungen und -produkten in den Bereichen Fahren, Laden und Speichern die Dekarbonisierung voran. Der Schwerlastverkehr steht dabei im Fokus. Die Firma produziert seit mehreren Jahren kundenspezifische E-Lkw in den Bereichen Recyclinglogistik, Baulogistik sowie Verteil- und Landwirtschaftslogistik. Ihre Reichweite beläuft sich im Realeinsatz auf bis zu 500 Kilometer. Die Nachfrage nach den batterieelektrischen Lkw wächst kontinuierlich. Auch seitens Schifffahrt kündigt sich Interesse am Betrieb von elektrifizierten Personen- und Autofähren auf Schweizer Seen an. Sowohl die Kundenanfragen als auch die Ergebnisse der Analysetätigkeit des Unternehmens deuten auf einen wachsenden Bedarf an batterieelektrischen Nutz- und Sonderfahrzeugen mit hoher Reichweite und langer Betriebsdauer hin. Mit dem Projekt Megawatt-Batterie-Ladesystem für schwere Nutzfahrzeuge will die Unternehmung gemeinsam mit Partnern dieser Situation Rechnung tragen. Deshalb zielt sie auf die Bereitstellung der notwendigen Ladetechnik ab, um so die Elektrifizierung schwerer Fahrzeuge zu ermöglichen. Gleichzeitig will die Designwerk Technologies AG dazu beitragen, dass der dafür notwendige Ladestandard innerhalb der Schweiz non-proprietär und konform mit bereits bestehenden Grundlagen der laufenden Normierung ist.
Die wissenschaftliche Begleitung dieser technischen Entwicklungen wird vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt. Das BFE fördert mit seinem Pilot- und Demonstrationsprogramm (P+D-Programm) die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien, Lösungen und Ansätze im Bereich der sparsamen und effizienten Energienutzung, der Energieübertragung und
-speicherung sowie der Nutzung erneuerbarer Energien. Das P+D-Programm positioniert sich dabei an der Schnittstelle zwischen Forschung und Markt und zielt darauf ab, den Reifegrad neuer Technologien zu erhöhen, um sie letztlich zur Marktreife zu bringen.
Erklärte Ziele des Projektteams
Im Rahmen des Projekts wird ein Megawatt-Batterie-Ladesystem-Prototyp mit einem manuellen und international konformen Stecksystem entwickelt, gebaut, getestet und erprobt.
Das System soll die Schnellladung schwerer E-Trucks innert 45 Minuten ermöglichen. Das Gesamtsystem findet in einem mobilen Container Platz, was den flexiblen Einsatz ermöglicht. Das Steckersystem orientiert sich dabei an weltweiten Standards. Das batteriegestützte System soll sich zudem netzdienlich verhalten können und den Einsatz sogenannter Second-Life-Batterien ermöglichen. Die Puffer sollen dabei sowohl Spitzenlasten kappen als auch Lastverschiebungen erlauben. Dies soll zur Entlastung der Netze und der Senkung der Netzanschluss sowie -energiekosten dienen.
Neben der technischen Machbarkeit wird mit dem Projekt die wirtschaftliche und ökologische Zweckmässigkeit des batterieelektrischen Langstreckenschwerverkehrs untersucht. Begleitend zum Projekt werden deshalb sowohl Wirtschaftlichkeits- als auch Nachhaltigkeitsanalysen durch involvierte Fachhochschulen durchgeführt. Das Gesamtsystem soll dem wirtschaftlichen Vergleich mit konventionellen Energietransfersystemen mindestens standhalten. Gleichzeitig sollen Transportunternehmen und auch die Gesellschaft als Ganzes über die Vorteile der E-Mobilität im Schwerlastverkehr informiert werden, um zum Bewusstsein für neue Lösungen beizutragen. Das Systemdesign muss dabei die Gegebenheiten der Schweizer Netzinfrastruktur berücksichtigen.
Funktionsprinzip des Megawatt-Ladesystems
Die Batteriepuffer sowie die Leistungselektronik und die dazugehörende Elektrik- und Elektronik-Hardware sind in einem Container eingebaut und vor äusseren Einflüssen geschützt. Der nach UN38.3 transportierbare Ladecontainer beinhaltet Batteriepakete mit einer Speicherkapazität von insgesamt 1’800 Kilowattstunden. Die Entladeleistung beläuft auf bis zu 1,8 Megawatt, respektive auf bis zu 2,1 Megawatt unter Einbezug des Netzanschlusses. Optional sollen zwei Ladepunkte mit je einem MCS- und einem CCS-Stecksystem implementiert werden, um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten.

Grafik: Rendering Megawatt-Batterie-Ladesystem für schwere Nutzfahrzeuge
Design des Gesamtsystems und technische Spezifikation
Der Megawatt-Batterie-Ladesystem-Prototyp ist modular aufgebaut und kann den lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Er besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:
- Netzanschluss
- DC-Zwischenkreis
- Ladeschnittstellen A sowie B mit MCS- und CCS-Stecksystem
- Energieverteilung
- Batteriespeicher
- Interne Spannungsversorgung
- Steuerung
- Batterieheizung und -klimatisierung
Die Besonderheit und der Innovationsschwerpunkt liegen insbesondere beim Stecksystem.
Diesbezüglich stehen die Entwicklerinnen und Entwickler vor mehreren Herausforderungen. Dazu gehören etwa die Auslegung der gesamten Elektrotechnik, die Ladekommunikation sowie die Konstruktion und das Ladekonzept der Nutzer an sich.
Neuer Ladestandard namens MCS
Um die internationale Operabilität und Kompatibilität von Ladestationen und Fahrzeugen zu gewährleisten, implementieren Fahrzeughersteller Ladestandards.
Zwei davon – darunter der sogenannte Combined Charging Standard CCS, und der Megawatt Charging System Standard MCS, stammen von der Charging Interface Initiative e. V., kurz CharIN. Die Non-Profit-Organisation steht allen Unternehmen im Bereich der Elektromobilität offen. Sie ist eine Plattform für die industrieübergreifende Zusammenarbeit von Lieferanten und Herstellern.
Die Task Force Megawatt Charging System wurde 2018 ins Leben gerufen. Sie repräsentiert die gesamte Wertschöpfungskette der Schwerlastfahrzeug-Industrie. Sie ist integraler Bestandteil der Fokus-Gruppe Charging Connection, welche die Harmonisierung und Weiterentwicklung der CCS-Ladetechnologie im Bereich der erweiterten Anwendungen (Elektroflugzeuge, Fähren und andere Wasserfahrzeuge) vorantreibt. Das neue MCS-Ladestecksystem soll sich weltweit etablieren. Mit der frühzeitigen Standardisierung können die Skalierbarkeit und der flächendeckende Einsatz des Systems gefördert werden. Zurzeit ist unter Federführung der Task Force ein entsprechender Normungsentwurf für das Laden mit Leistungen im Megawattbereich in Erarbeitung. Dabei handelt es sich um IEC 62196-23-3: Electric vehicle conductive charging system – DC electric vehicle supply equipment for Me-gawatt charging systems.
Stand des Projekts und Ausblick
Systementwicklung und Realisierung
Im Zuge der Systementwicklung wurden die Anforderungen an das Megawatt-Batterie-Ladesystem definiert und analysiert. Damit ist die mechanische, die elektrische sowie die sicherheitstechnische Konzeption abgeschlossen. Erstellt sind auch die Konzepte zur Steuerung, zum Thermomanagement sowie zum Testing der Anlage. Mit der Realisation des Prototyps hat die Designwerk Technologies AG in der zweiten Jahreshälfte 2022 begonnen. Wesentliche Teile der Leistungselektronik, des Speichers und der Kühlung sind mittlerweile verbaut.
Aktuelle Herausforderungen
Die aktuellen Herausforderungen im Projekt sind geradezu typisch für die Industrie, in der das Projektteam tätig ist: Bei der Lieferung der Komponenten zum Bau der Pilotanlage kam es zu verschiedenen Lieferverzögerungen seitens Lieferanten. Diese waren unter anderem auf die COVID-19-Pandemie sowie die Chip-Krise zurückzuführen. In einem Fall wurde ein Sublieferant gar Opfer einer Cyber-Attacke. Gleichzeitig sind qualifizierte Fachkräfte im entsprechenden Gebiet knapp. Die Grösse des Entwicklerteams bleibt deshalb überschaubar.
Ausblick
Das Demonstrationsprojekt ist derzeit im Gang. Nach der Inbetriebnahme sind zunächst Tests bei Murg Flums Energie geplant. Dabei werden Netzrückwirkungen, das Potenzial beim Lastmanagement sowie der Eigenverbrauchsoptimierung und die Anbindung an den Regelenergiemarkt untersucht.
Seitens der Berner Fachhochschule BFH wird anhand von zyklischen Alterungsmessungen analysiert, wie sich das Laden auf die Batterien auswirkt und wo die ökonomische Nutzschwelle des Systems liegt. Die Ostschweizer Fachhochschule OST unterstützt zudem beim Thermomanagement, bei den Energiemarktanalysen sowie bei der Ökobilanzierung des Systems.
Zudem erfolgen Langzeit-Praxistests in Zusammenarbeit mit der Galliker Transport AG sowie der Käppeli Logistik AG. Hier wird sich künftig zeigen, wie praxistauglich das MCS-Stecksystem respektive die Containerlösung ist.
Unumstösslich scheint hingegen bereits heute die Erkenntnis, dass bei der Erreichung der Klimaziele dem Schwerverkehr eine überaus wichtige Rolle zukommt. Die Entwicklung neuer, leistungsstarker Ladestationen trägt diesem Umstand Rechnung und dürfte damit ein entscheidendes Puzzleteil darstellen, um das Gesamtbild einer emissionsarmen beziehungsweise emissionsfreien Transportwirtschaft zu erreichen.